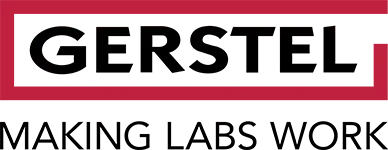Fleischersatz und Aromastoffe
Bei der Herstellung von Fleischalternativen gehen Biotechnologie und Instrumentelle chemische Ana-lytik Hand in Hand
Die Biotechnologie kann sich bei der Gewinnung natürlicher Aromastoffe und der Verbesserung der organoleptischen Eigenschaften veganer Ersatzprodukte als „Gamechanger“ erweisen. Die instrumentelle chemische Analytik, insbesondere die Thermodesorptions-GC/MS, spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle, und zwar nach Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) der Aromastoffe aus der Fermentationsbrühe.
Guido Deußing
Das ist die Ausgangslage: Sowohl die Industrie als auch die Wissenschaft arbeiten daran, den Geschmack und das Aroma von pflanzlichem Fleischersatz möglichst dem des fleischlichen Originals anzunähern. Die Biotechnologie spielt aus Sicht von Forschenden der Universität Hohenheim eine zentrale Rolle bei der Herstellung natürlicher Aromastoffe. Stöppelmann et al.[1-3] haben ein biotechnologisches Fermentationssystem entwickelt, mit dem sich gezielt fleischähnliche Aromen auf pflanzlicher Basis erzeugen lassen, und zwar indem gelbe Zwiebeln (Allium cepa L.) in Submerskulturen gezielt mit ausgewählten Basidiomyceten fermentiert wurden.
Eine kurze Detailbetrachtung: Bei den Zutaten für die biotechnologische Fermentation handelte es sich um das Myzel eines Schwefelporlings (Laetiporus sulphureus) und kleingehackte Gelbe Zwiebeln (Allium cepa L.): Zwiebel liefern freie, schwefelhaltige Aminosäuren wie Cystein und Methionin, die wichtig sind für die Maillard-Reaktion und damit Vorläufer von Fleischgeschmack. Das Pilzmyzel nutzt den in Zwiebeln enthaltenen Zucker als Fermentationssubstrat, sprich als Nahrung, und verstoffwechselt, was die Zwiebel an Molekülen anzubieten hat zu butterig-rahmigen Ketonen, fett-fleischigen Aldehyden und Alkoholen. Die Fermentationsbrühe verströmt, wie Stöppelmann et al. berichten, fleischige und talgig-fettige Geruchseindrücke, die stark an gebratene Frikadellen erinnern.
Fleischaromen auf der Spur: Um den mit der Nase gewonnenen Eindruck qualifizieren respektive quantifizieren und wirtschaftlich nutzen zu können, ist es wichtig zu wissen, wie sich das Aromaprofil der Fermentationsbrühe zusammensetzt und welche Aromastoffe das fleischähnliche Aroma im Wesentlichen prägen. Stöppelmann et al. führten unter Einsatz sensorisch geschulter Panelisten eine sensorische Prüfung durch und gingen dann zur instrumentellen chemischen Analyse der an gebratenen Frikadellen riechenden Fermentationsbrühe über. Die Forschenden der Universität Hohenheim verwendeten die Thermodesorptions-Gaschromatographie (TD-GC) gekoppelt an die Massenspektrometrie (MS) und eine olfaktorische Bestimmung (O). Die TD-GC-MS/O-Analyse dient der Qualifizierung respektive Semiquantifizierung der aromaaktiven Verbindungen. Die Aromastoffe und Aromavorläufer sind dafür aber zuvor aus der Fermentationsbrühe zu extrahieren und in eine analysierbare Form zu überführt. Stöppelmann et al. wählten für diesen Zweck die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) mit dem GERSTEL-Twister. Genauer gesagt führten die Forschenden eine sogenannte Multiple-SBSE (mSBSE) durch, indem sie zwei Twister-Rührstäbchen im Probenvial einsetzten – ein Twister wurde unmittelbar in die Proben gegeben, der andere im Headspace oberhalb der Probe befestigt.
Ergebnis der SBSE-TD-GC-MS/O-Analyse: Die SBSE-TD-GC-MS/O-Analyse der fermentierten und nichtfermentierten Zwiebelhauptkultur habe insgesamt 62 geruchsaktive Regionen im Chromatogramm ergeben, „von denen 14 ausschließlich in der nichtfermentierten Rohkultur, elf nur in der fermentierten Zwiebelhauptkultur und 37 in beiden nachweisbaren waren. Die am häufigsten gefundenen Verbindungsklassen waren Aldehyde gewesen, gefolgt von Schwefelverbindungen, Ketonen und Lactone. Grüne und fettige, auf Aldehyde wie Pentanal und Undecanal zurückzuführende Geruchseindrücke, seien durch die Fermentation reduziert worden. Identifiziert wurden in der Fermentationsbrühe zudem (E,Z)-2,4-Decadienal (fettig, talkartig) und Benzothiazol (schwefelhaltig, brüheartig); die Geruchseindrücke dominierten den sensorischen Eindruck der Fermentationsbrühe.
Schlüsselaromen mittels GC/O identifiziert: Um herauszubekommen, wie der Schwefelporling das Aromaprofil der fermentierten Zwiebelhauptkultur beeinflusst, führten Stöppelmann et al. eine Semi-Quantitative Bestimmung der geruchsaktiven Verbindung unter Einsatz eines internen Standards (2-Methylthiophen) und einem Vergleich mit Standardlösungen der zu bestimmenden Aromastoffe durch. Es sei erforderlich, die Geruchaktivitätswerte (Odor Activity Value, OAV) festzustellen. Die olfaktorische Detektion parallel zur Massenspektrometrie spielte bei dieser Arbeit eine wichtige Rolle, da damit für das Aromaprofil relevante Geruchseindrücke wahrgenommen werden können, auch wenn das Massenspektrum respektive das Chromatogramm aufgrund zu geringer Stoffkonzentrationen oder mangels hinreichender Empfindlichkeit des der MSD kein Signal aufzeichnet.
Das Fazit der Forschenden: Stöppelmann et al. stellten fest, sowohl in der fermentierten als auch in der nichtfermentierten Zwiebelhauptkultur hätten zwölf Verbindungen vorgelegen, deren OAVs größer eins gewesen sei, „was darauf hindeutet, dass diese Verbindungen zu den Gesamtaromaprofilen beitragen“, insofern es keine synergetischen Effekte gäbe, schreiben die Forschenden. Die Fermentation führe zu einer Verschiebung in Aromaprofil, wobei drei Alkadienale in der fermentierten Hauptkultur die höchsten OAV aufwiesen, die aber nicht in Zwiebeln vorhanden gewesen wären. Hierbei handelte sich um die Aldehyde (E,E)-Nonadienal (fettig, frittiert), (E,Z)-2,4-Decadienal (fettig, talkartig) und (E,E)-2,4-Decadienal (fettig, frittiert). Die weitere Untersuchung u.a. mittels automatisierter Headspace-Festphasen-Microextraktions-GC-MS (HS-SPME-GC-MS; GERSTEL-MPS, Agilent 8890 GC und 5977B Inert Plus MSD) habe demnach für (E,Z)-2,4-Decadienal den größten OVA in der Fermentationslösung ergeben verbunden mit dem Aromaeindruck „pastetenartig“.
Ein Wort zum Schluss: Bei der Suche nach dem Entstehungsmechanismus fanden Stöppelmann et al. heraus, dass Linolensäure, die in Zwiebeln vorkommt, ein potenzieller Vorläufer sei, was im Zuge von Fütterungsexperimenten, sprich unter Zugabe von Linolensäure, bestätigt wurde. Es sei offenkundig, schreiben die Forschenden, dass L. Sulphureus die Fettsäure im Zuge der Fermentation enzymatisch verändere und damit den Aromaeindruck nachhaltig präge. Neben (E,Z)-2,4-Decadienal identifizierten sie in der fermentierten Probe den schwefel- und brüheartig riechenden Geruchsstoff Benziothiazol, der laut Stöppelmann et al. ebenfalls zum fleischig-herzhaften Aroma beitrage.
Referenzen
[1] Stöppelmann F, Chan LF, Hildebrand G, Hermann-Ene V, Vetter W, Rigling M, Zhang Y (2024). Molecular decoding a meat-like aroma generated from Laetiporus sulphureus-mediated fermentation of onion (Allium cepa L.). Food Research International 192: 114757. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114757
[2] Stöppelmann F, Zhang Yangyan (2025). Natürliche Fleischaromen durch Pilzfermentation: Basidiomyceten-Allium-Systeme im Scale-up und Anwendungstest. Deutsche Lebensmittel-Rundschau 121,8: 321-328
[3] Stöppelmann F, Chanc LF, Liang J, Greiß M, Lehnert AS, Pfaff C, Langen-berg T, Zhu L, Zhang Y (2023). Generation of Meaty Aroma from Onion (Allium cepa L.) with Polyporus umbellatus: Fermentation System, Sensory Profile, and Aroma Characterization. Journal of Agriculture and Food Chemistry 71: 13054-13065. https://www.doi.org/10.1021/acs.jafc.3c03153